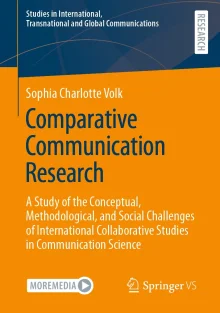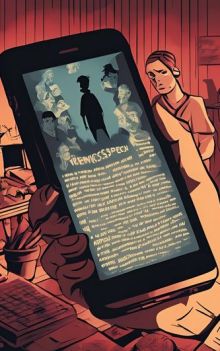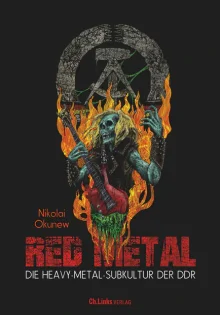
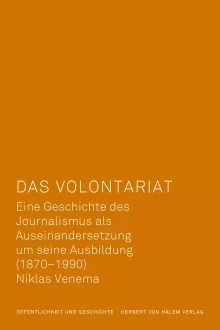
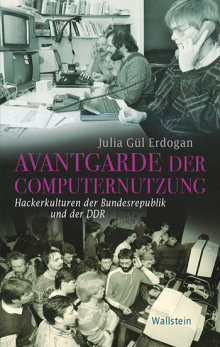
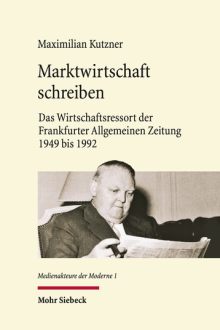
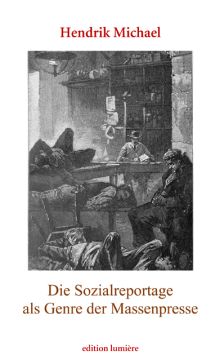

Seit 2017 finanziert die Ludwig-Delp-Stiftung den jährlich vergebenen "Zukunftspreis Kommunikationsgeschichte" (bis 2022: “Nachwuchspreis Kommunikationsgeschichte”).
Forschung und Wissenschaft brauchen Ansporn und Motivation. Daher zeichnet die Fachgruppe Kommunikationsgeschichte innerhalb derder Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft e.V. (DGPuK) erausragende Leistungen von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im weiten Feld der kommunikationsgeschichtlichen Forschung. Ziel des Preises ist es, junge Forscherinnen und Forschern beim Start in eine wissenschaftliche Laufbahn zu unterstützen - und mehr Aufmerksamkeit auf relevante Forschungsergebnisse zu lenken. Näheres dazu finden Sie unter https://www.dgpuk.de/de/nakoge.html.
Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind:
2023: Dr. Nikolai Okunew für seine an der Universität Potsdam entstandenen Dissertation “Red Metal. Die Heavy-Metal-Subkultur der DDR” und Sophia Merkel für ihre an der Hochschule der Medien Stuttgart als Mastarbeit angenommene Studie: “Nationalisierung der Kindheit durch Kindermedien im Deutschen Kaiserreich”.
2022: Dr. Niklas Venema für seine Doktorarbeit (Universität Leipzig) "Das Volontariat Eine Geschichte des Journalismus als Auseinandersetzung um seine Ausbildung (1870–1990)".
2021: Dr. Julia Gül Erdogan für ihre Dissertation (Universität Potsdam) "Avantgarde der Computernutzung. Hackerkulturen der Bundesrepublik und der DDR".
2020: Dr. Maximilian Kutzner für seine Dissertation (Universität Würzburg) “Marktwirtschaft schreiben. Das Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1949 bis 1992”, Hendrik Michael für seine Doktorarbeit (Universität Bamberg): “Die Sozialreportage als Genre der Massenpresse. Erzählen im Journalismus und die Vermittlung städtischer Armut in Deutschland und den USA (1880–1910)” und Mandy Tröger für Ihre Dissertation (University of Illinois): “On Unregulated Markets and the Freedom Of Media. The Transition of the East German Press after 1989”
2019: Dr. Katrin Jordan für ihre Dissertation (Universität Potsdam) „Ausgestrahlt. Die mediale Debatte um ‚Tschernobyl‘ in der Bundesrepublik und Frankreich 1986/87 “ und Carmen Schaeffer ihre Masterarbeit (FU Berlin) „Gegen ‚Schmutz und Schund‘ in der populären Jugendliteratur Wie Zusammenschlüsse der Lehrerschaft versuchten, den Medienwandel um 1900 zu beeinflussen und zu regulieren“.
2018: Dr. Anna Jehle für Ihre Dissertation (Universität Potsdam) „Welle der Konsumgesellschaft. Radio Luxembourg in Frankreich 1945-1975", Dr. Andre Dechert für seine Doktorarbeit (Universität Augsburg) „Dad on TV: Sitcoms, Vaterschaft und das Ideal der Kernfamilie, 1981-1992“ und Daniel Wollnik für seine Masterarbeit (Univeristät Bochum) „Die gesellschaftliche Implementierung des Telefons in Japan im 19. Jahrhundert – Eine Analyse aus diskursgeschichtlicher Perspektive".
2017: Dr. Julia Pohle für Ihre Dissertation (Universität Brüssel) “Information For All? The emergence of UNESCO's policy discourse on the information society (1990-2003)”, Julia Lönnendonker für Ihre Doktorarbeit (TU Dortmund) "Konstruktionen europäischer Identität. Eine Analyse der Berichterstattung über die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 1959 bis 2004" und Stefanie Mathilde Frank für Ihre Doktorarbeit (HU Berlin) “Wiedersehen im Wirtschaftswunder. Remakes von Filmen aus der Zeit des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik 1949–1963”.